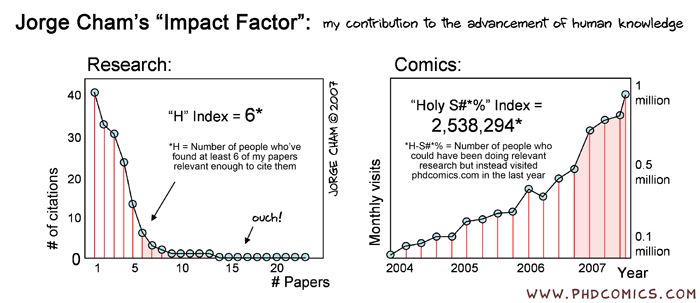Diese Woche gibt es wieder einen Gastbeitrag von Christine Stedtnitz. Christine promoviert in Politikwissenschaft an der University of Essex in Colchester. Ihre Freizeit verbringt sie allerdings lieber in London, wo es den besseren Kaffee gibt. Sie hat für uns zusammengefasst, was man beim Promovieren wirklich lernt. Heute geht es los mit Teil 1: Akademische Weisheiten.
 Ein Professor, das weiß jedes Kind, ist ein bärtiger älterer Herr, der jeden Nachmittag bis in die frühen Abendstunden mit einer kubanischen Zigarre im linken Mundwinkel in einem Sessel vor seinem Kamin sitzt, und seinen Blick abwechselnd in ein dickes, ledergebundenes Buch und, nachdenklich, in das knisternde Feuer wirft. Er schläft jeden Morgen bis 8 Uhr, schlürft jeden Morgen um halb 9 seinen frisch gebrühten Filterkaffee, von dem jeden Morgen mindestens ein paar Tropfen seine FAZ schmücken, spaziert um Punkt 9:55 los zur 10 Uhr-Vorlesung, lässt pünktlich um viertel nach 10 seine Ledertasche auf das Pult plumpsen, betrachtet eingehend und leicht kurzsichtig sein mit Zunahme der Semesterwochenzahl schwindendes Publikum und ergreift nach einem kurzen Augenblick, so er denn Naturwissenschaftler ist, die weiße Kreide oder, so er denn Geisteswissenschaftler ist, die kubanische Zigarre und richtet sich, der Naturwissenschaftler vor der Tafel und der Geisteswissenschaftler auf dem hölzernen Stuhl, den seine Sekretärin nun wirklich doch einmal auswechseln sollte, ein. Und doziert. Ab 10.20 Uhr ist er so in seine Vorlesung vertieft, dass ihn weder das Mitschreiben der fleißigen Kommilitonen noch das beschauliche Schnarchen der letzten Reihen sonderlich beeindruckt; erst der Gong um 11.45 Uhr unterbricht – rüde! – seinen Gedankengang und somit seine Vorlesung. „Auf Wiedersehen“ sagt er bevor er den letzten Satz zu Ende sprechen konnte, erfreut sich der klopfenden Masse, und bewegt sich sogleich in die Mensa, wo er alltäglich um Punkt 12 seine Fachgenossen zum Feierabend trifft. (Denn an das Mensaessen hat er sich bereits vor 40 Jahren gewöhnt.) Nach der Kohlroulade macht er sich auf und spaziert nach Hause (das mit dem Laufen hat ihm sein Arzt verordnet und sein Haus befindet sich selbstverständlich in bester Wohnlage, fußläufig zur innerstädtischen Universität.) Dort legt er sich erst einmal auf einen 45-minütigen Mittagsschlaf je nach Saison in die Hängematte oder das Sofa. Dann, um Punkt 15 Uhr, ergreift er sein Buch, seine Zigarre, und sein abgewetztes Notizbuch und liest und schreibt, bis ihn seine Frau oder seine Haushälterin – rüde! – zum Abendessen beordert.
Ein Professor, das weiß jedes Kind, ist ein bärtiger älterer Herr, der jeden Nachmittag bis in die frühen Abendstunden mit einer kubanischen Zigarre im linken Mundwinkel in einem Sessel vor seinem Kamin sitzt, und seinen Blick abwechselnd in ein dickes, ledergebundenes Buch und, nachdenklich, in das knisternde Feuer wirft. Er schläft jeden Morgen bis 8 Uhr, schlürft jeden Morgen um halb 9 seinen frisch gebrühten Filterkaffee, von dem jeden Morgen mindestens ein paar Tropfen seine FAZ schmücken, spaziert um Punkt 9:55 los zur 10 Uhr-Vorlesung, lässt pünktlich um viertel nach 10 seine Ledertasche auf das Pult plumpsen, betrachtet eingehend und leicht kurzsichtig sein mit Zunahme der Semesterwochenzahl schwindendes Publikum und ergreift nach einem kurzen Augenblick, so er denn Naturwissenschaftler ist, die weiße Kreide oder, so er denn Geisteswissenschaftler ist, die kubanische Zigarre und richtet sich, der Naturwissenschaftler vor der Tafel und der Geisteswissenschaftler auf dem hölzernen Stuhl, den seine Sekretärin nun wirklich doch einmal auswechseln sollte, ein. Und doziert. Ab 10.20 Uhr ist er so in seine Vorlesung vertieft, dass ihn weder das Mitschreiben der fleißigen Kommilitonen noch das beschauliche Schnarchen der letzten Reihen sonderlich beeindruckt; erst der Gong um 11.45 Uhr unterbricht – rüde! – seinen Gedankengang und somit seine Vorlesung. „Auf Wiedersehen“ sagt er bevor er den letzten Satz zu Ende sprechen konnte, erfreut sich der klopfenden Masse, und bewegt sich sogleich in die Mensa, wo er alltäglich um Punkt 12 seine Fachgenossen zum Feierabend trifft. (Denn an das Mensaessen hat er sich bereits vor 40 Jahren gewöhnt.) Nach der Kohlroulade macht er sich auf und spaziert nach Hause (das mit dem Laufen hat ihm sein Arzt verordnet und sein Haus befindet sich selbstverständlich in bester Wohnlage, fußläufig zur innerstädtischen Universität.) Dort legt er sich erst einmal auf einen 45-minütigen Mittagsschlaf je nach Saison in die Hängematte oder das Sofa. Dann, um Punkt 15 Uhr, ergreift er sein Buch, seine Zigarre, und sein abgewetztes Notizbuch und liest und schreibt, bis ihn seine Frau oder seine Haushälterin – rüde! – zum Abendessen beordert.
Was also lernt ein Doktorand oder eine Doktorandin? Einfach. So wie Prinz William sich auf das Königsein vorbereitet, bereitet sich der oder die Promovierende auf das Professorsein vor. Man liest, recherchiert, denkt, schreibt und trinkt ungemein viel Kaffee.
Das mit dem Kaffee sollte sich als wahr herausstellen.
Continue reading “Was man in einer Promotion wirklich lernt – Teil 1”


 Ein Professor, das weiß jedes Kind, ist ein bärtiger älterer Herr, der jeden Nachmittag bis in die frühen Abendstunden mit einer kubanischen Zigarre im linken Mundwinkel in einem Sessel vor seinem Kamin sitzt, und seinen Blick abwechselnd in ein dickes, ledergebundenes Buch und, nachdenklich, in das knisternde Feuer wirft. Er schläft jeden Morgen bis 8 Uhr, schlürft jeden Morgen um halb 9 seinen frisch gebrühten Filterkaffee, von dem jeden Morgen mindestens ein paar Tropfen seine FAZ schmücken, spaziert um Punkt 9:55 los zur 10 Uhr-Vorlesung, lässt pünktlich um viertel nach 10 seine Ledertasche auf das Pult plumpsen, betrachtet eingehend und leicht kurzsichtig sein mit Zunahme der Semesterwochenzahl schwindendes Publikum und ergreift nach einem kurzen Augenblick, so er denn Naturwissenschaftler ist, die weiße Kreide oder, so er denn Geisteswissenschaftler ist, die kubanische Zigarre und richtet sich, der Naturwissenschaftler vor der Tafel und der Geisteswissenschaftler auf dem hölzernen Stuhl, den seine Sekretärin nun wirklich doch einmal auswechseln sollte, ein. Und doziert. Ab 10.20 Uhr ist er so in seine Vorlesung vertieft, dass ihn weder das Mitschreiben der fleißigen Kommilitonen noch das beschauliche Schnarchen der letzten Reihen sonderlich beeindruckt; erst der Gong um 11.45 Uhr unterbricht – rüde! – seinen Gedankengang und somit seine Vorlesung. „Auf Wiedersehen“ sagt er bevor er den letzten Satz zu Ende sprechen konnte, erfreut sich der klopfenden Masse, und bewegt sich sogleich in die Mensa, wo er alltäglich um Punkt 12 seine Fachgenossen zum Feierabend trifft. (Denn an das Mensaessen hat er sich bereits vor 40 Jahren gewöhnt.) Nach der Kohlroulade macht er sich auf und spaziert nach Hause (das mit dem Laufen hat ihm sein Arzt verordnet und sein Haus befindet sich selbstverständlich in bester Wohnlage, fußläufig zur innerstädtischen Universität.) Dort legt er sich erst einmal auf einen 45-minütigen Mittagsschlaf je nach Saison in die Hängematte oder das Sofa. Dann, um Punkt 15 Uhr, ergreift er sein Buch, seine Zigarre, und sein abgewetztes Notizbuch und liest und schreibt, bis ihn seine Frau oder seine Haushälterin – rüde! – zum Abendessen beordert.
Ein Professor, das weiß jedes Kind, ist ein bärtiger älterer Herr, der jeden Nachmittag bis in die frühen Abendstunden mit einer kubanischen Zigarre im linken Mundwinkel in einem Sessel vor seinem Kamin sitzt, und seinen Blick abwechselnd in ein dickes, ledergebundenes Buch und, nachdenklich, in das knisternde Feuer wirft. Er schläft jeden Morgen bis 8 Uhr, schlürft jeden Morgen um halb 9 seinen frisch gebrühten Filterkaffee, von dem jeden Morgen mindestens ein paar Tropfen seine FAZ schmücken, spaziert um Punkt 9:55 los zur 10 Uhr-Vorlesung, lässt pünktlich um viertel nach 10 seine Ledertasche auf das Pult plumpsen, betrachtet eingehend und leicht kurzsichtig sein mit Zunahme der Semesterwochenzahl schwindendes Publikum und ergreift nach einem kurzen Augenblick, so er denn Naturwissenschaftler ist, die weiße Kreide oder, so er denn Geisteswissenschaftler ist, die kubanische Zigarre und richtet sich, der Naturwissenschaftler vor der Tafel und der Geisteswissenschaftler auf dem hölzernen Stuhl, den seine Sekretärin nun wirklich doch einmal auswechseln sollte, ein. Und doziert. Ab 10.20 Uhr ist er so in seine Vorlesung vertieft, dass ihn weder das Mitschreiben der fleißigen Kommilitonen noch das beschauliche Schnarchen der letzten Reihen sonderlich beeindruckt; erst der Gong um 11.45 Uhr unterbricht – rüde! – seinen Gedankengang und somit seine Vorlesung. „Auf Wiedersehen“ sagt er bevor er den letzten Satz zu Ende sprechen konnte, erfreut sich der klopfenden Masse, und bewegt sich sogleich in die Mensa, wo er alltäglich um Punkt 12 seine Fachgenossen zum Feierabend trifft. (Denn an das Mensaessen hat er sich bereits vor 40 Jahren gewöhnt.) Nach der Kohlroulade macht er sich auf und spaziert nach Hause (das mit dem Laufen hat ihm sein Arzt verordnet und sein Haus befindet sich selbstverständlich in bester Wohnlage, fußläufig zur innerstädtischen Universität.) Dort legt er sich erst einmal auf einen 45-minütigen Mittagsschlaf je nach Saison in die Hängematte oder das Sofa. Dann, um Punkt 15 Uhr, ergreift er sein Buch, seine Zigarre, und sein abgewetztes Notizbuch und liest und schreibt, bis ihn seine Frau oder seine Haushälterin – rüde! – zum Abendessen beordert.
 Der heutige Beitrag stammt von unserer Gastautorin Johanna Spangenberg. Johanna promoviert seit April 2017 am Internationalen Doktorandenkolleg
Der heutige Beitrag stammt von unserer Gastautorin Johanna Spangenberg. Johanna promoviert seit April 2017 am Internationalen Doktorandenkolleg